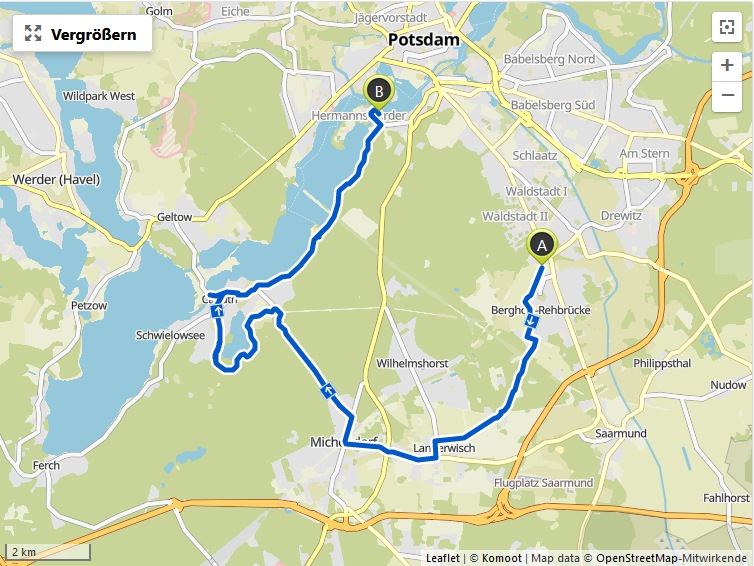Werkschau des märkischen Landschaftsmalers Karl Hagemeister
An heißen Tagen wie diesen ist es im Potsdam Museum dank Klimatisierung schön kühl und sommerliche Landschaften gibt es obendrauf. Sogar die Ostsee mit stürmischen Wellen schickt eine kühle Brise zum Alten Markt.
„…das Licht, das ewig wechselt“ gibt die selbst formulierte künstlerische Auffassung von Karl Hagemeister um 1884 wieder. Es war die Intention des Malers, Naturphänomene wie Licht, Wind und Wolken darzustellen und dabei etwas nicht fassbares in Form und Farbe aufzuzeigen. Es sind die Gedanken eines noch Suchenden, der wie viele moderne Künstler seiner Zeit das unmittelbare Skizzieren in der Natur als bildwürdiges Sujet begriff. Der in Werder an der Havel geborene Künstler (1848-1933) gehört zu den bedeutenden Vertretern des deutschen Impressionismus und war ein Wegbereiter der moderen Landschaftsmalerei. Das Potsdam Museum besitzt in seiner Kunstsammlung einen umfangreichen Werkbestand und würdigt das bedeutende Vermächtnis Hagemeisters mit einer umfassenden Retrospektive.
Führung durch Markus Wicke
Markus Wicke, Vorsitzender des Fördervereins des Potsdam Museums, führte am 13. August 2020, eine erste Gruppe von Mitgliedern des Kulturstadtvereins durch die Ausstellung. Mit einer Spendensammlung ermöglichte der Verein die Restaurierung dieses Hagemeister-Gemäldes.
![Karl Hagemeister: Uferlandschaft [Schilfufer], 1900, Öl auf Leinwand, Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte. Repro: Michael Lüder](https://kulturstadt.potsdam.de/wp-content/uploads/2019/08/Uferlandschaft_fb-1024x623.jpg)
Beim Ausstellungsrundgang sind 88 Arbeiten zu sehen, darunter 18 bedeutende Gemälde weiterer Künstler, angefangen von Friedrich Preller d. Ä., Carl Schuch, Francois Daubingy, Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt, Lesser Ury, bis hin zu Walter Leistikow, welche die Entwicklung der modernen Landschaftsmalerei zur Jahrhundertwende veranschaulichen. Eine vergleichende Gegenüberstellung des Malers Hagemeister und seiner Zeitgenossen wird anhand von ausgewählten Öl- und Pastellarbeiten möglich.
Wir danken Markus Wicke für die engagierte Führung durch die einzigartige Ausstellung. Die Mitglieder sind erfreut über die Bildqualität nach der Restaurierung. Gratulation zum Besucherrekord, trotz Corona!
Bis 6. September 2020 dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Besuch ohne Voranmeldung möglich, allerdings unter Beachtung der üblichen Hygienevorschriften.